Ein unterstützender Ansatz hierfür kann Nudging sein. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler intuitiv „angestupst“, die für sie und die Gesellschaft günstigeren Entscheidungen zu treffen. Damit diese tatsächlich beim Essen und Trinken Berücksichtigung finden, ist ein gesundheitsförderliches und nachhaltiges Angebot eine unverzichtbare Grundlage.
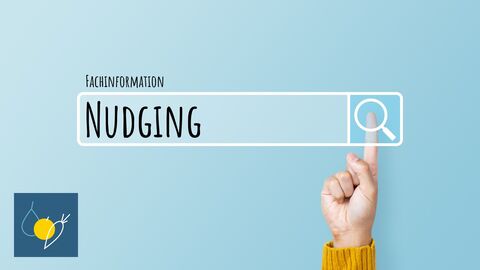
Fachinformation
Nudging in der Gemeinschaftsverpflegung
Lesedauer:3 Minuten
Nudging
Nudging bedeutet im Englischen „anstupsen“. Diese „Anstupser“ (nudges) stehen für kleine, gezielte, dem Empfänger unbewusste Impulse, die das Verhalten beeinflussen. Dafür wird die jeweilige Umgebung so gestaltet, dass dies intuitiv eine günstigere Entscheidung auslöst. Es entsteht also eine neue Entscheidungsarchitektur: Dies ist ein zentraler Teil des Nudging-Ansatzes. Um jedoch von Nudging sprechen zu können, müssen nach Thaler und Sunstein1 drei Voraussetzungen zutreffen:
- Die Wahlmöglichkeiten (im Angebot) müssen bestehen bleiben.
- Der Anstupser, also der nudge, muss einfach zu umgehen sein.
- Die Maßnahmen des Nudgings dienen dem Wohl des Einzelnen oder der Gesellschaft, das heißt sie sind ethisch und moralisch vertretbar.
Nudging kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, vorrangig bei Themen, die gesellschaftlich relevant sind, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und Gesundheit. So ist auch eine gesundheitsförderliche und nachhaltige Ernährung, die sich an den Empfehlungen des DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung in Schulen orientiert, ein erstrebenswertes Ziel und kann daher „angestupst“ werden. So kann das Ernährungsverhalten positiv beeinflusst werden.
„Beim Nudging werden die Schülerinnen und Schüler intuitiv angestupst, die für sie und die Gesellschaft günstigeren Entscheidungen zu treffen. Um diese tat- sächlich beim Essen und Trinken zu berücksichtigen, ist ein gesundheitsförderliches und nachhaltiges Angebot eine zentrale Basis.“
Nudging und Ernährungsverhalten
Um nachvollziehen zu können, wo und wie Nudging beim Ernährungsverhalten ansetzt, ist ein knapper Blick auf die verschiedenen Verhaltenssysteme und die Entscheidungsfindung hilfreich: Das Verhalten von Menschen wird nur zum Teil bewusst gesteuert. (Unbewusste) Gewohnheiten und situative Faktoren prägen das Verhalten erheblich. Dies gilt grundsätzlich für jedes Verhalten und somit auch für das Ernährungsverhalten.
Es lassen sich zwei Systeme zur Steuerung des menschlichen Verhaltens unterscheiden. Diese Systeme unterscheiden sich grundständig: Während System 1 schnell, automatisch und unbewusst abläuft, ist für System 2 typisch, dass bewusste, kontrollierte und eher langsame Entscheidungen darüber getroffen werden. Die Übergänge zwischen den Systemen können fließend sein. Im Feld Ernährung ist praktisch vielfach das System 1 aktiv, da es sich beim Essen und Trinken oft um routinemäßige, schnelle und unbewusste Entscheidungen handelt.
Nudging im Kontext von Ernährung setzt meist beim System 1 an und will durch die Gestaltung der Ess-Umgebung auf die unbewussten, schnellen Entscheidungen gezielt Einfluss nehmen. Die Menschen, die angestupst werden sollen, müssen über diese gezielt gesetzten Impulse (nudges) nicht informiert sein, damit sie wirksam sind. Der Nudging-Ansatz kann somit als Ergänzung zu den vielen auf Wissensvermittlung gerichteten Kampagnen (zum Beispiel IN FORM), eingesetzt werden, die eher auf eine kognitive Verarbeitung der Informationen abzielen und darüber zweckmäßige Entscheidungen erreichen wollen (System 2).
Ansatz in (Ganztages-)Schulen und Schulverpflegung
Immer dann, wenn es darum geht das Wohl des Individuums und der Gesellschaft zu fördern, ist Nudging eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, auf das Verhalten intuitiv Einfluss zu nehmen. Es bietet sich vor allem in Ganztagsschulen an, da Schülerinnen und Schüler hier einerseits gemeinsam viele Stunden Zeit verbringen (Lernen und Freizeit) und andererseits die- se Zeit auch prägend für ihren weiteren Lebensweg ist.
Prävention für Nachhaltigkeit und Gesundheit
Prävention ist der Überbegriff für alle zielgerichteten Maßnahmen, die Schäden vermeiden, ihr Risiko reduzieren oder ihr Auftreten verzögern sollen. Im Feld der Prävention und Gesundheitsförderung kann unterschieden werden in Verhältnis- und Verhaltensprävention.
Verhältnisprävention
Sie verfolgt das Anliegen, über die Gestaltung der Umfeldbedingungen einen positiven Einfluss auf die Nachhaltigkeit und Gesundheit zu nehmen.
Die Gemeinschaftsverpflegung in der Schule ist der Verhältnisprävention zuzuordnen (zum Beispiel: Angebot an nachhaltiger Mittags- und Zwischenverpflegung verknüpft mit Nudging).
Verhaltensprävention
Sie richtet sich darauf, das individuelle Verhalten zu beeinflussen.
Hierunter fallen unter anderem Maßnahmen, die die Gesundheits- und Nachhaltigkeitskompetenzen von Individuen fördern, zum Beispiel im Unterricht und in Projekten in der Schule.
Auf die Notwendigkeit der Verknüpfung der beiden Säulen hat Pudel schon vor Jahrzehnten hingewiesen: Das Zusammenwirken der Prävention sowohl auf der Ebene individuellen Verhaltens, aber insbesondere auch auf der Ebene der kollektiven Verhältnisse ist wichtig, da bisher weder Ernährungsaufklärung noch Ernährungsberatung ihr Ziel erreicht haben.
Idealerweise sind in der Schule beide Bereiche, also Verhältnis- sowie Verhaltensprävention, verknüpft, um eine möglichst große Wirkung zu erzielen. Am nachfolgenden Beispiel soll dies exemplarisch aufgezeigt werden: Das Aufstellen von Trinkwasserspendern in der Schule kann das gesundheitsförderliche und nachhaltige Trinken „anstupsen“ (Verhältnisprävention). Im Unterricht wird die Bedeutung des Themas zum Beispiel anhand der Lebensmittelpyramide aufgegriffen (Verhaltensprävention); idealerweise erfolgt ein Transfer ins Elternaus, unter anderem über einen Infozettel.
Im Setting Schule gilt es auch, Verantwortung für gesundheitsförderliches und nachhaltiges Essen und Trinken zu übernehmen, denn die Gemeinschaftsverpflegung kann das Verhalten von Personen durch Maßnahmen der Verhältnisprävention langfristig beeinflussen. Idealerweise ergeben sich dann Synergieeffekte auf das individuelle Verhalten, so dass hier dann auch die Verhaltensprävention greift.
Ganztägig arbeitende Schulen bieten einen breit gefächerten Handlungsspielraum: auf der Steuerungsebene, der Unterrichtsebene, in der Mensaausstattung sowie im Bereich der Partizipation, wo überall die Nudging-Maßnahmen effektiv gestaltet werden können. Ein gesundheitsförderliches Ernährungskonzept für den ganzen Tag soll laut Qualitätsrahmen gemeinsam mit dem Schulträger umgesetzt werden.
„Anstupsen“ durch Partizipation
Partizipation und Schulkultur stellen zwei der wesentlichen Qualitätsbereiche des Ganztags dar. Die Partizipation bei der Verpflegung hat viele Vorteile für Schülerinnen und Schüler, für die Schule und für die Gesellschaft. Anliegen von Schülerbeteiligung sind die Nutzung und Entwicklung von Kompetenzen des selbstregulierten Lernens und des demokratischen Handelns.
Hierfür ist die Verpflegung in Mensa und Kiosk ein Idealer Ort, denn im Gegensatz zu anderen Bereichen in der Schule, bei denen es diverse verpflichtende staatliche Regularien gibt, ist das bei der Schulverpflegung wenig der Fall (mit Ausnahme der Hygienebestimmungen). Schülerpartizipation ermöglicht es Lernenden, systematisch auf Planung, Gestaltung und Reflexion Einfluss zu nehmen, sei es auf die Lern- und Schulkultur und/oder die Verpflegung.
Partizipation selbst kann auch als Nudge interpretiert werden, da dies intuitiv einen Einfluss auf das Ernährungsverhalten haben kann. Partizipation kann auf verschiedenen Stufen erfolgen:
Die Schülerinnen und Schüler können an Informationsbesuchen in der Mensa teilnehmen, und erfahren, warum das Angebot in einer bestimmten Art gestaltet ist (zum Beispiel gesundheitsförderlich, nachhaltig), sie werden dabei auch über Planungen zu Nudging-Maßnahmen informiert.
Schülerinnen und Schüler können im Mensa-Ausschuss Vorschläge einbringen, zum Beispiel zum Angebot oder zu Nudging-Maßnahmen. Sie können abgestimmte Vorschläge – etwa zur Gestaltung von Nudging-Maßnahmen im Eingangsbereich der Mensa – mit umsetzen oder sie können Lob und Kritik zu den umgesetzten Nudges einbringen und erhalten Rückmeldungen dazu.
Schülerinnen und Schüler können als Projekt zum Beispiel den Speiseplan gesundheitsförderlich und nachhaltig mitgestalten und dabei gleichzeitig auch Nudging-Maßnahmen für ihre Mensa mitüberlegen. Sie können eine Schülerfirma (zum Beispiel Kiosk) betreiben und dort mit Nudging-Maßnahmen experimentieren (planen, umsetzen, Erfolge messen).
Vorgehen und Umsetzung in der Schulverpflegung
Voraussetzung für Nudging ist, dass es ein nachhaltiges und gesundheitsförderliches Angebot gibt (zum Beispiel auf der Basis der DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung in Schulen oder der RAL-Gütezeichen- Kompetenz „Richtig Essen“). Für die Entwicklung und Umsetzung von Nudging-Maßnahmen in der Praxis ist ein strukturiertes Vorgehen zielführend. Idealerweise werden die relevanten Akteurinnen und Akteure vor Ort mit „ins Boot“ genommen.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Passung von Versorgungs- und Bildungsauftrag in der Schule. Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt:
Analyse
Attraktivität des gesundheitsförderlichen Angebots, Datenlage und Systematik des Kassensystems für die Maßnahmen, aktuelle Verkaufszahlen ermitteln, Laufwege der Gäste beobachten, Zufriedenheit der Gäste, Optimierungspotenziale ermitteln
Planung
schulspezifische Maßnahmen festlegen, beteiligtes Personal beziehungsweise die gesamte Schulgemeinde involvieren, Beschäftigte schulen
Durchführung
Testlauf durchführen und begleiten, Pilotprojekt evaluieren, entscheiden, welche Maßnahmen dauerhaft umgesetzt werden sollen, Umsetzung kontinuierlich begleiten
Evaluation
Erfolgsmessung durchführen: Ausgangssituation und Umstellung (Kassendaten), kontinuierliche Verbesserung
Verstetigung
Maßnahmen auf Dauer in die Alltagsroutinen aufnehmen, gegebenenfalls neue Maßnahmen planen.
Zur Umsetzung – unter Beteiligung sowohl des Schulträgers als auch der gesamten Schulgemeinde – eignen sich schulische Gremien zur Qualitätssicherung und -entwicklung. Wie die Umsetzung eines Mensakreises gelingen kann, zeigt unter anderem der Praxisleitfaden „Miteinander im Dialog – Schulverpflegung gestalten“. Für die schrittweise Implementation einer gelingenden Schulverpflegung gibt es bereits arbeitserleichternde Materialien, die Sie von der Analyse der aktuellen Situation über die Formulierung von Zielen und Maßnahmen bis hin zu deren Evaluation unterstützen.
Ansätze und Kategorisierung
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Nudges zu strukturieren und damit besser handhabbar zu machen. Verschiedene Autoren haben sich dazu Systematisierungen überlegt. Aufbauend auf verschiedenen Kategorisierungen finden Sie im Folgenden diverse Beispiele für mögliche Nudging-Maßnahmen im Feld Ernährung und Verpflegung.
Einer der „Väter“ des Nudgings, Cass Sunstein, veröffentlichte die aus seiner Sicht zehn wichtigsten Nudges für die Politik, wobei diese Einteilung auch über die Politik hinaus genutzt werden kann (zum Beispiel im Hinblick auf Ernährung, Umwelt, Finanzen):
- Default Regel (Standardoptionen verändern)
- Vereinfachung
- Soziale Normen
- Erhöhung der Bequemlichkeit und Einfachheit
- Offenlegung von Informationen
- Warnhinweise
- Strategien der Selbstbindung
- Erinnerungen
- Appell an Absichten
- Informationen über Konsequenzen früheren Verhaltens.
Eine weitere mögliche Unterteilung von Nudges hat die Arbeitsgruppe um Holland vorgenommen, die eine Kategorisierung von Nudges im Gesundheitsverhalten erforscht hat. Am Entscheidungsort kann demnach eine Veränderung vorgenommen werden bei:
- den Eigenschaften von Objekten und/oder Stimuli (zum Beispiel Ambiente, Etikettierung, Portionsgrößen)
- der Platzierung von Objekten und/oder Stimuli (zum Beispiel Verfügbarkeit, Erreichbarkeit)
- den Eigenschaften und der Platzierung von Objekten und/oder Stimuli (zum Beispiel Priming, Prompting).
Die verschiedenen Kategorisierungen von Nudges zeigen, dass je nach Kontext und Anliegen eine unterschiedliche Strukturierung der Nudges zweckmäßig sein kann. In der Praxis der Schulverpflegung kann jedes der Kategorie-Systeme angewendet werden. Letztendlich wird vor Ort entscheidend sein, welches für den jeweiligen Betrieb am passendsten erscheint und womit die beteiligten Akteurinnen und Akteure gut zurechtkommen.
Die Umsetzung kann sowohl von den Caterern bzw. Speisenanbietenden sowie von der gesamten Schulgemeinde vorangetrieben werden und sollte somit auch Teil des Verpflegungskonzeptes sein. Entsprechende Maßnahmen tragen somit verhältnispräventiv und in Folge auch verhaltenspräventiv zu einer gesundheitsförderlichen Gestaltung des Ganztags bei.
Viele Anregungen lassen sich nicht nur schnell, sondern auch einfach und günstig im Schulalltag umsetzen. Zur nachhaltigen Verankerung und Umsetzung empfiehlt sich ein gemeinsamer Dialog mit dem Caterer und der gesamten Schulgemeinde.
Fazit
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ (Erich Kästner): Das gilt auch für Nudging in der Schulverpflegung.
Da sich viele Maßnahmen relativ einfach umsetzen lassen, bietet ein Probelauf die Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln und diese dann in schulische Routinen einfließen zu lassen und auszubauen.
Fest steht: Nudging wirkt und kann – neben der Ernährungsinformation und Ernährungsbildung – eine zweckmäßige Ergänzung zur Umsetzung von Nachhaltigkeit und Gesundheit im Setting Schule sein.
Fachliche Expertise
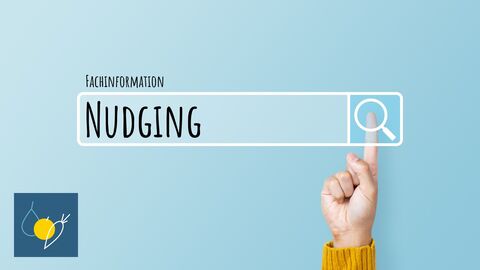
Fachinformation
Nudging
Prof. Dr. Sibylle Adam
Professorin für Ernährungswissenschaften
Prof. Dr. Ulrike Pfannes
Professorin für Verpflegungs- und Versorgungsmanagement